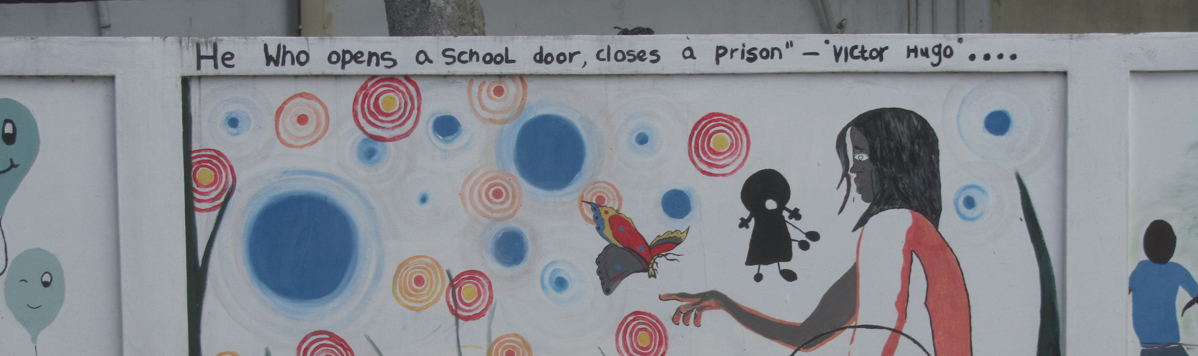
Reportage „Der Rudi macht nicht mehr mit“
von Michael OHNEWALD (Reihe Stuttgarter Reportagen)
Rebellen unserer Zeit. Sie schwimmen nicht wie Schnittlauch auf allen Suppen. Sie sind anders. Sie wehren sich. Sie sind moderne Rebellen.
Viele Jahre lang hat der passionierte Pädagoge Rudolf Bosch still unter dem Niedergang der Hauptschule gelitten. Als es anfing wehzutun, schrieb er einen Protestbrief. Seitdem ist der Schulrebell aus Oberschwaben versetzungsgefährdet.
Von Michael OHNEWALD, Stuttgarter Zeitung 23. Januar 2010
Man kann sich das vorstellen, als würde jemand mit einer stumpfen Nadel gegen einen Luftballon drücken, der bis zum Äußersten gespannt ist. Das geht eine Weile gut. Irgendwann droht das Ding zu platzen.
Es hat sich ganz langsam angestaut bei Rudolf Bosch, der bis vor kurzem ein braver Beamter war, den nur wenige kannten, ein Hauptschullehrer mit Leib und Seele, der seinem Tagwerk leise murrend nachging. Eines Morgens musste er ein Ventil öffnen, weil es ihn sonst verrissen hätte. Seitdem hat der Rektor der Ravensburger Kuppelnauschule eine Menge Ärger und landesweit einen Ruf wie Donnerhall.
Wenn man verstehen will, wie es so weit kommen konnte, muss man sich mit Rudolf Bosch in sein kleines Tonstudio im Keller verziehen, wo es sich ungestört plaudern lässt. Dort kommt die weiche Seite des Hausherrn zum Vorschein, der nie ein Revoluzzer sein wollte. Rudolf Bosch, schnittige Randlosbrille, Trotz im Blick, schnappt seine E-Gitarre und spielt Songs von Marc Cohn und den Beatles. Er mag es melodiös Im Hintergrund brummt der Heizlüfter. Ein Notenblatt aus der Schweiz liegt beim Mischpult. Der Text gefällt ihm.„Meine Gedanken, sie reißen die Schranken und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei.“
Mit Mauern lebt Rudolf Bosch schon lange, mit Mauern in Köpfen, mit Mauern, die stehen, noch bevor man geboren ist, mit politisch gesetzten Mauern, mit solchen, die man nicht sehen, aber fühlen kann.
Den Anfang macht die Fügung. Rudolf Bosch kommt 1952 in Stuttgart als Sohn eines Bäckers zur Welt und wächst im Hegau mit vier jüngeren Geschwistern auf. Weil die Eltern hart arbeiten müssen, ist der Älteste als Erzieher gefordert. „Der Rudi macht das“, heißt es. Sowas prägt.
In der Grundschule wird ihm zum ersten Mal bewusst, wie das ist, wenn man gegen eine Mauer rennt, die nicht da sein sollte. Wums! „Der Rudi ist praktisch begabt“, befindet sein Lehrer in der Grundschule. „Der kommt auf die Realschule.“ Seine Geschwister sind handwerklich weniger geschickt. Sie dürfen aufs Gymnasium.
Der Rudi fügt sich, auch deshalb, weil die Bäckerei der Familie in Engen nach zwei Überschwemmungen dichtmacht und sein Vater in der Not als Hilfsarbeiter bei Maggi anheuern muss. Der Sohn lenkt sich mit seiner Gitarre ab, schreibt Lieder und Texte. Unterricht kann sich die Familie für ihn nicht leisten. Rudi macht das selbst.
Nach der mittleren Reife wechselt er auf das Technische Gymnasium. Eigentlich will er Toningenieur werden, aber dann steht ihm die Pädagogik näher, weil er das Erziehen von Haus aus gewohnt ist. Rudolf Bosch studiert an der PH in Weingarten und wird Junglehrer an der Grund- und Hauptschule im oberschwäbischen Baindt. Dort gibt es zu jener Zeit viele Gastarbeiter, die in einer Papierfabrik beschäftigt sind. Ihre Kinder heißen Muammar oder Selma, und viele von ihnen haben in der Türkei die Schule besucht. Jetzt hat man sie nach Deutschland geschickt. Hier haben sie weitere drei Jahre auf einer deutschen Schule vor sich, ohne ein Wort zu verstehen.
Zum zweiten Mal begegnet Bosch der Mauer, und der Rudi, wie ihn die Kollegen nennen, donnert voll dagegen. „Ich spürte eine Verantwortung für diese Kinder“, sagt er. Eine besondere Förderung gibt es für die Türkenkinder Ende der siebziger Jahre nicht. Die meisten laufen im Unterricht nebenher. In Bosch regt sich das Gewissen: „Die darfst du nicht hängen lassen!“
Mit Kollegen baut er Förderklassen auf, führt offene Unterrichtsformen ein, sucht das Gespräch mit den Eltern. Seine Pionierarbeit spricht sich bis zum Schulamt herum. Bald wird er Fachberater für Ausländerpädagogik. Der Rudi hängt sich rein. Den meisten seiner Schützlinge hilft er über die Klippe der Hauptschulprüfung. Manchmal trifft er sie Jahre später wieder und reibt sich verwundert die Augen, weil sie es weiter gebracht haben, als selbst er das für möglich gehalten hätte.
Rudolf Bosch wird Konrektor in Obereschach, gründet eine Familie, unterrichtet Mathe, Sport und Musik. Im Stillen arbeitet er gegen die Auslese an. „Nach dreieinhalb Jahren auf der Grundschule wird bei uns ein junger Menschauf zwei Noten reduziert, auf die wir dann Zukunftschancen erteilen“, wettert er. „Die Grenzen, die dieses System setzt, sind viel zu eng!"
Sätze wie diese sagt er anfangs nur im kleinen Kreis. Der Rudi will keine Politik machen, sondern Schule. Er setzt sich für freieren Unterricht ein, bei dem mehrere Lehrer vor einer Klasse stehen, er baut die Elternarbeit aus, versucht die ihm anvertrauten Kinder stark zu machen statt sie über allzu strenge Benotung zu beschämen.
Man kann es Sturheit nennen, was ihn antreibt, man kann es aber auch leise Verzweiflung nennen. Die Verzweiflung über Bildungskarrieren, die von der Herkunft bestimmt werden, überTausende junger Menschen, die im Land jedes Jahr ohne Schulabschluss bleiben, über ein selektives Bildungssystem,
„das fast schoneine Dreiklassengesellschaft abbildet“. Wie viele engagierte Lehrer im Land unterrichtet er dagegen an.
Bosch erklimmt die letzte Stufe auf der Karriereleiter. 1997 wird er Rektor der Ravensburger Kuppelnauschule. In sein Büro flattert oft Post vom Kultusministerium. Ein Fitnessprogramm für die Hauptschule löst das nächste ab. Nur noch ein Viertel der Schulkinder wechseln nach der vierten Klasse dorthin. Die Zahl der Einsprüche gegen die Bildungsempfehlung Hauptschule steigt. Das Land reagiert mit immer neuen Reformvorschlägen. Für Bosch liegen die Gründe längst anderswo. „Das gesellschaftliche Ansehen einer Familie orientiert sich bei uns heute an der Schulwahl“, sagt er. „Und die Hauptschule befindet sich in der Hierarchie der Schulabschlüsse ganz unten.“
Der Rektor spürt, dass er Teil eines Auslaufmodells ist, und versucht das Beste aus der Lage zu machen. Aber ist das Beste noch gut genug? Er gibt keinen verloren und ächtet Lehrersätze wie: „Hast du das jetzt immer noch nicht kapiert? Bisch du jetzt bleed?“ Sowas geht gar nicht bei ihm.
Tatenvoll muss er zusehen, wie die Hauptschule trotz allem weiter ausblutet. Auch sonst stößt ihm manches auf im weiten Bildungsreich des Landes. Als Vater von Töchtern, die auf das Gymnasium gehen, registriert er, wie sich der Stoff verdichtet; wie mehr als fünfzig Prozent der Schüler nur mit Nachhilfe zum Ziel kommen; wie Scharen von Kindern wegen des wachsenden Drucks zu Psychologen rennen; wie immer öfter „Bulimie-Lernen“ auf dem Stundenplan steht: rein mit dem Stoff, bei der Klassenarbeit wieder raus, und nach vier Wochen ist fast alles vergessen. „Das hat mit nachhaltigem Lernen nichts zu tun“, grantelt Bosch. „Was soll das bringen in Zeiten, in denen solches Wissen jederzeit übers Internet verfügbar ist?“
Manchmal verkriecht er sich in seinen Keller, knipst den Verstärker an und spielt lautstark gegen die Resignation beim täglichen Erkennen der Wahrheit an. Ein motiviertes Kollegium hat er, gute Ideen und doch ist er am Ende nur Wasserschöpfer auf einem sinkenden Schulschiff, das unter christdemokratischen Kapitänen streng Kurs hält. Andere Bundesländer steuern in der Bildungspolitik um, obwohl sie unterschiedlich regiert werden. In Baden-Württemberg bleibt es, wie es ist.
Irgendwann muss es raus. Rudolf Bosch kann den Tag genau benennen. Der 15. März 2007. „Land verordnet den Hauptschulen ein Fitnessprogramm“, liest er in seiner Zeitung. An diesem Morgen verwandelt sich der Staatsdiener in einen Störenfried. Erst telefoniert er, dann schreibt er. Mit drei Kollegen schickt Bosch einen offenen Protestbrief gegen das dreigliedrige Schulsystem an Kultusminister Helmut Rau, der sich darüber mächtig grämt.
Mehr als hundert oberschwäbische Schulleiter unterschreiben den Brief. Wie Bosch treten sie dafür ein, dass Kinder über die vierte Klasse hinaus gemeinsam lernen und erst später aufgeteilt werden, wie das in erfolgreichen Pisa-Ländern praktiziert wird. Die Starken werden mit den Schwachen nicht schlechter, lautet ihre These. „Unser selektives System täuscht eine nach Begabungen homogene Schülergruppe vor, die vorwiegend im gleichschrittigen, darbietenden Unterricht beschult werden könne“, sagt Rudolf Bosch. „Das beschert uns jedes Jahr viele Schulversager.“
Kaum dass er sich die Finger wund geschrieben hat, wird ihm schon heftig auf dieselben geklopft. Beim Kultusminister fällt Bosch in Ungnade, und Stefan Mappus, der Schwabenpremier in spe, fordert allen Ernstes seine Ablösung. Dienstrechtliche Konsequenzen werden geprüft. Gleich zweimal muss der Schulrebell zum Rapport ins Tübinger Regierungspräsidium.
So leicht lässt sich einer wie er nicht mundtotmachen. Seit ihn die Regierenden in Stuttgart als Meuterer geächtet haben, hängt er sich noch mehr rein. In seiner Hauptschule in Ravensburg und darüber hinaus. Mit anderen hat Bosch die Initiative „Länger gemeinsam lernen“ gegründet, die breite Unterstützung erfährt. Das tut gut. Es gibt aber auch Andersdenkende, solche, die nichts halten von einer Operation am offenen Herzen des Bildungssystems. „Ich kenne Gymnasiallehrer, die wechseln die Straßenseite, wenn sie mir begegnen“, erzählt Rudolf Bosch. „Die sagen: der hat sie nichtmehr alle.“
Er bleibt trotzdem, was er ist, ein Stachel im Fleisch der Bildungspolitik. Verbände und Parteien laden ihn zu Vorträgen ein. Der Rudi ist immer gut für ein paar kernige Sätze. Man muss ihm nur ein Stichwort hinhalten wie ein Streichholz, und schon brennt es. Die neue Werkrealschule ist so ein Stichwort. „Sie ist ein Etikettenschwindel und ein flächendeckendes Schulschließungsprogramm, bei dem Kommunen, Schulen und Lehrer gegeneinander ausgespielt werden.“
Der Tag geht, die Mauer steht noch immer. Er könnte schweigen, statt sich an ihr abzuarbeiten. Er könnte es nett haben in seinem Tonstudio und dort Songs von den Beatles spielen. „Let it be.“ Es sind nur noch ein paar Jahre bis zur Pension.
„Nein“, sagt er und runzelt die Stirn über den stahlblauen Augen, „es muss möglich sein, eine solche Bildungsdiskussion zu führen.“ Aus Liebe zum Beruf, aus tiefer Überzeugung und wegen der beiden Enkel. „Damit sie vielleicht eine andere Schule erleben.“ Opa Rudi wird sein Möglichstes tun.
Wie die Geschichte im Original auf einer ganzen Seite in der Zeitung abgedruckt und mit Bildern und Überschriften ge-layoutet war, können Sie hier als pdf-Datei anschauen: Der Rudi macht nicht mehr mit
Online am: 25.01.2016
Inhalt:
- Rudolf BOSCH – ein engagierter Lehrer
- Reportage „Der Rudi macht nicht mehr mit“
- Der Offene Brief von 96 Lehrern und Lehrerinnen an ihren höchsten Dienstherrn
Tags:
(Aus)Bildung | Kinder | Michael OHNEWALD | Reportage | Schule + Ausbildung | Stuttgarter Reportagen | Stuttgarter Zeitung
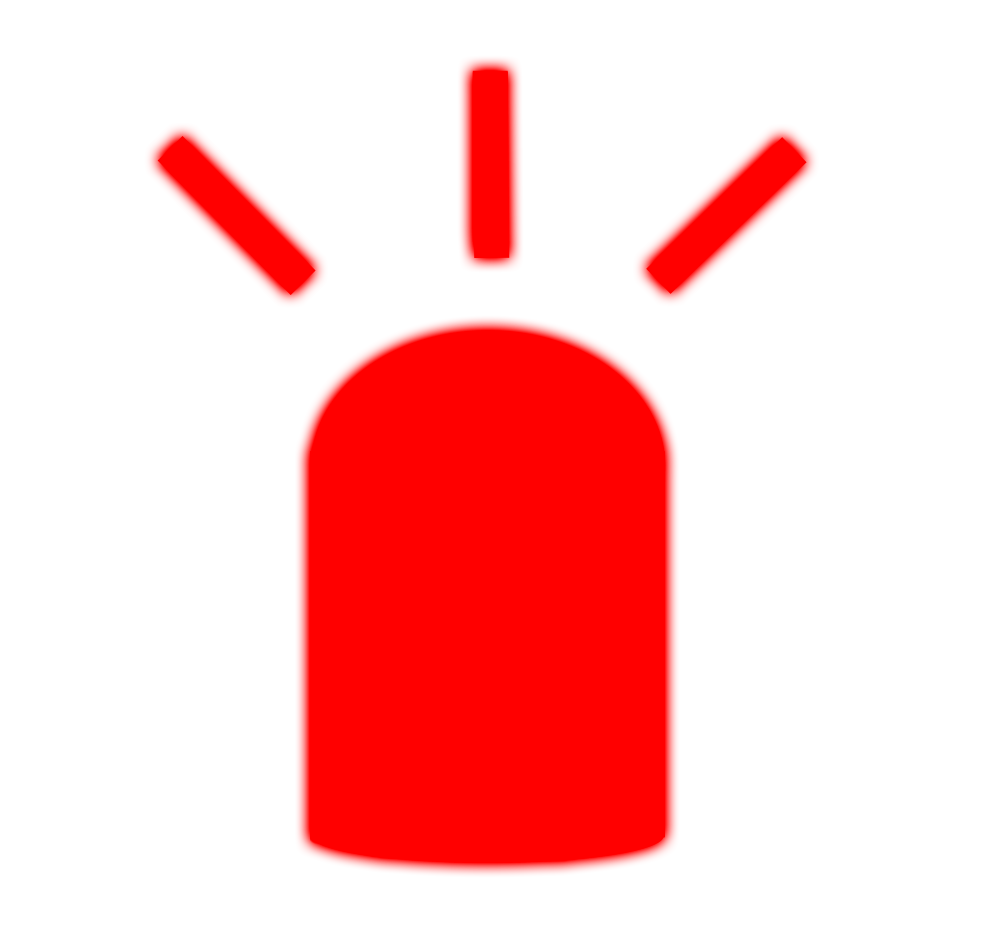
Whistleblower
Dies ist die Geschichte eines Whistleblowers
